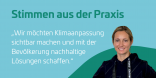Im Interview: Simone Podschun zu digitalen Tools in der Hochwasservorsorge
Bits gegen Fluten – Digitale Tools für die Klimaanpassung in der Hochwasservorsorge
Im Interview mit Dr. Simone Podschun, Zentrum KlimaAnpassung
Die Häufigkeit und Intensität von Hochwasser- und Starkregenereignissen nimmt infolge des Klimawandels deutlich zu. Für Kommunen, Unternehmen und Bürger*innen besteht daher dringender Handlungsbedarf, um Risiken und Schäden zu verringern. Die zunehmenden Starkregenereignisse sowie die Abfolge verschiedener Extremereignisse müssen also in den Kommunen stärker berücksichtigt werden. Dabei eröffnen technische Entwicklungen neue Wege für eine moderne, digitale Vorsorge.
Dr. Simone Podschun vom Zentrum KlimaAnpassung (ZKA) ist GIS-Expertin und verfügt über langjährige Erfahrung in der Klimaanpassung urbaner Räume sowie der Bewertung der Leistungsfähigkeit von Flüssen und Auen. Sie gibt Einblicke in digitale Werkzeuge rund um das Thema Hochwasser.
ZKA: Wie definiert sich Hochwasser – und wie hängt dies mit Starkregen zusammen?
Simone Podschun (S.P.): Nach § 72 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) bezeichnet Hochwasser „eine zeitlich beschränkte Überschwemmung von normalerweise nicht mit Wasser bedecktem Land, insbesondere durch oberirdische Gewässer“. Diese Definition sagt jedoch zunächst nichts über die Ursachen aus – und genau hier lohnt ein genauer Blick. Klassische Hochwasserereignisse entstehen häufig durch großflächige, langanhaltende Niederschläge (Dauerregen) oder Schneeschmelze, oft in Verbindung mit gesättigten Böden im Einzugsgebiet. Kann das Wasser nicht mehr versickern, fließt es oberflächlich in die Gewässer ab, die daraufhin über die Ufer treten.
Die Bundesländer erstellen hierzu Hochwassergefahrenkarten, die unter anderem das HQ100 abbilden – also jene Flächen, die statistisch einmal in 100 Jahren überflutet werden. Solche Ereignisse entwickeln sich meist langsam, sind räumlich an große Gewässer gebunden und daher vergleichsweise gut vorherzusagen. Die Karten zeigen unter anderem Ausdehnung, Wassertiefe und Fließgeschwindigkeit und sind bundesweit im kostenlosen Hochwasseratlas öffentlich einsehbar. Ergänzend stellt das Länderübergreifende Hochwasserportal aktuelle Pegeldaten und amtliche Warnungen bereit. Um potenziell Betroffene zu identifizieren, werden außerdem Hochwasserrisikokarten erstellt, die Gefahrengebiete mit Einwohnerzahlen, Nutzungen, umweltrelevanten Industrien oder kulturell bedeutsamen Objekten kombinieren (LAWA 2024a).
Die gute Nachricht ist also, wir verfügen über eine solide und über Bundesländer hinweg abgestimmte Datengrundlage, die dank technischer Fortschritte immer präziser wird. Während früher Daten im 10-m-Raster verarbeitet wurden, sind heute unter 1-m-Auflösungen möglich – mit zunehmender Genauigkeit bis auf Grundstücksebene. Die Herausforderung: Klimawandelbedingte Veränderungen verschieben die zugrunde liegenden Wahrscheinlichkeiten. Ereignisse, die früher als HQ100 klassifiziert wurden, können heute einer höheren Eintrittswahrscheinlichkeit entsprechen. Wir sollten daher einen “Klimazuschlag” in Betracht ziehen – wie Prof. Birkmann es in unserem aktuellen Podcast beschreibt. Zudem nehmen Starkregenereignisse zu – und diese werden in klassischen Hochwassergefahrenkarten bislang nur unzureichend abgebildet (LAWA 2024a). Deshalb arbeitet die Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser seit einigen Jahren an einer bundesweiten Strategie für ein effektives Starkregenrisikomanagement (LAWA 2024b). Starkregenereignisse treten lokal, intensiv und oft ohne Vorwarnzeit auf. Sie können selbst in kleinen, unauffälligen Gewässern oder völlig gewässerunabhängig zu Sturzfluten führen. Viele Kommunen sind auf diese Form des Hochwassers unterschiedlich gut vorbereitet. Die DWA fordert daher, die Überflutungsvorsorge flächendeckend „klimafest“ zu machen – also Hochwasser und Starkregen gemeinsam zu denken (DWA 2022).
Digitale Tools können dabei unterstützen: Integrierte, datengetriebene Systeme ermöglichen es, schneller zu reagieren – so schnell, wie das Wasser kommt. Neben klassischen baulichen Maßnahmen wie Retentionsräumen, Rückhaltesystemen und Entsiegelung, die letztendlich Zeit „kaufen“, treten digitale Werkzeuge zunehmend als zusätzlicher Hebel hinzu.
ZKA: Welche digitalen Möglichkeiten gibt es für die Hochwasservorsorge?
S.P.: Die Bandbreite digitaler Werkzeuge reicht von Sensorik (Pegel-, Niederschlags- und Kanalrückstaumessungen) über KI-gestützte Kurzfristprognosen und Entscheidungsunterstützungssysteme bis hin zu automatisierten Alarmierungen. Diese Technologien ermöglichen einen echten Paradigmenwechsel.
Ein Beispiel ist der Einsatz von LoRaWAN-Sensorennetzwerken. Die Long Range Wide Area Network-Technologie ist ein energiesparender IoT-Kommunikationsstandard, der kleine Datenmengen über große Distanzen übertragen kann – ideal für ein dichtes Messnetz. Im Projekt NiersCon im Kreis Viersen werden etwa Echtzeitdaten zu Wasserständen, Bodenfeuchte und Temperatur erhoben, um ein Grabensystem aktiv zu steuern. So können in Trockenzeiten Rückhaltekapazitäten erhöht und bei Starkregen die Ableitung verbessert werden. Die Klimaanpassung an Dürre und Starkregen wird hier interkommunal und auf Kreisebene organisiert. Ein weiteres Beispiel ist das Gewässerentwicklungskonzept der Bocholter Aa, bei dem digitale Tools und eine starke interkommunale Zusammenarbeit Hand in Hand gehen, um Maßnahmen über Gemeindegrenzen hinweg abgestimmt zu planen.
Digitale Werkzeuge ergänzen dabei die fachliche Expertise – sie erweitern Vernetzung und Austausch um die Ebene der Daten. Eine leistungsfähige Dateninfrastruktur ist daher ein Schlüssel für smarte Regionen und Städte. Neben der Hochwasservorsorge spielen solche Tools auch in der Hitzevorsorge und weiteren Klimafolgen eine wachsende Rolle. Die Stadt Dresden hat etwa einen „Starkregenzwilling“ entwickelt, der mit einer beeindruckenden 3D-Gebäudemodellierung Starkregengefahren visualisiert. Dies fördert Eigenvorsorge, erleichtert die Risikokommunikation und verbessert Warnprozesse, u.a. mithilfe einer Bürgerwarnapp.
ZKA: Es geht also über Hochwasservorsorge hinaus?
S.P.: Ja. Immer mehr Kommunen setzen auf umfassende digitale Lösungen für ihre spezifischen Herausforderungen. Das Berliner Smart Water-Projekt erprobt digitale Ansätze für eine klimaresiliente Stadt. Ein Baustein ist das Hochwasser-Infoportal – ein adressbasiertes Gefahrenportal, das Bürger*innen konkrete, auf ihre Wohnadresse zugeschnittene Handlungsempfehlungen gibt. Zudem wurden zahlreiche Daten zu Blau-Grünen Maßnahmen über ein Sensorennetzwerk erhoben. Die Ergebnisse fließen in einen Infrastrukturplaner ein, der natürliche und technische Lösungen intelligent kombiniert. So entsteht eine klimaangepasste Stadtplanung der Zukunft.
Ein weiteres innovatives Beispiel ist der Digitale Zwilling der Stadt Wuppertal. Er ermöglicht Fachämtern, Bürger*innen und Interessensgruppen, planerische Veränderungen – etwa durch Entsiegelung, Retentionsflächen oder naturnahe Gewässerentwicklung – visuell nachzuvollziehen. Dadurch werden komplexe Prozesse transparent, die Akzeptanz steigt und Beteiligung wird erleichtert. Solche Projekte markieren einen Paradigmenwechsel: Digitalisierung verändert nicht nur die Hochwasservorsorge, sondern die gesamte Stadtverwaltung. Dabei können anfangs Widerstände entstehen, weshalb der Aufbau menschlicher Netzwerke und regelmäßiger Austausch entscheidend bleiben.
ZKA: Was ist Deine Vision für digitale Tools in der kommunalen Klimaanpassung?
S.P.: Ein großer Vorteil der digitalen Transformation ist, dass Lösungen immer häufiger auf andere Regionen übertragbar sind. Was gestern ein Forschungsprojekt war, kann morgen bereits flächendeckend eingesetzt werden. In Hessen etwa soll das digitale Starkregenfrühalarmsystem, das sich in Pilotregionen bewährt hat, nun auf die Hälfte des Bundeslandes ausgeweitet werden. Das finde ich besonders wichtig, denn digitale Tools sollten auch für weniger finanzstarke Kommunen verfügbar sein. Meine Vision ist daher eine flächendeckende, interoperable Plattform, die alle relevanten Daten zu Hochwasser-, Starkregen- und weiteren Klimafolgen bündelt und sowohl Verwaltung als auch Bürger*innen präzise Warnsysteme und Handlungsempfehlungen bietet. Sie würde das bestehende länderübergreifende Hochwasserportal um spezifische Daten zu Niederschlägen, Trockenheit, Hitze und sozialen Aspekten erweitern. Gleichzeitig könnten Risikokarten um Informationen zu vulnerablen Gruppen und wichtigen sozialen Einrichtungen ergänzt werden, um die soziale Dimension von Klimafolgen und Maßnahmen sichtbar zu machen. Digitale Tools unterstützen nicht nur bei der Hochwasservorsorge, sondern erleichtern auch integrierte Planung zu Hitze, Klimaschutz oder weiteren Themen. Klimaanpassung und Digitalisierung sind als Querschnittsaufgaben zu verstehen – auf den ersten Blick eine Mammutaufgabe für Verwaltungen, aber zugleich eine große Chance, fachübergreifende Vernetzung, Bürgerbeteiligung und Information effizienter zu gestalten.
Quellen & aktuelle Grundlagen:
LAWA (2024): Empfehlungen zur Aufstellung von Hochwassergefahrenkarten und Hochwasserrisikokarten
Dr. Simone Podschun, Zentrum KlimaAnpassung